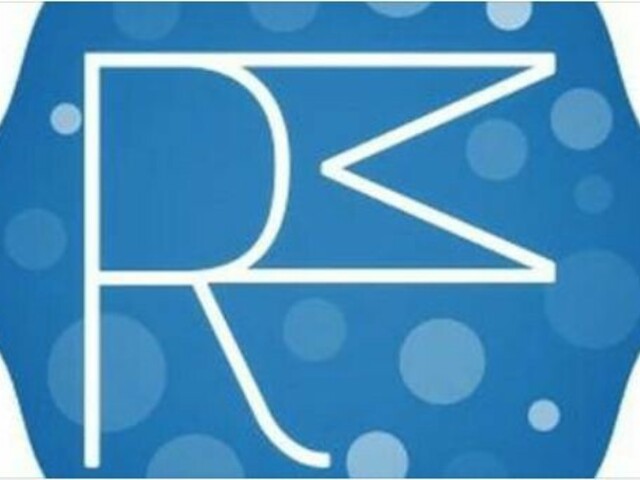Die russische Armee und die "Soldatenmütter"
Zwei Seiten im Tschetschenienkrieg
Tagelang dauerten die Gefechte gegen die tschetschenischen Rebellen - dann, vor kurzem erst, konnten russische Einheiten strategisch wichtige Positionen im Zentrum der Hauptstadt Grósny einnehmen. Etwa 2.000 Freischärler haben daraufhin - nach verschiedenen übereinstimmenden Angeben - die Stadt verlassen. Aber: Selbst wenn die russischen Truppen bald ganz Grosny kontrollieren sollten, bedeutet das noch nicht den endgültigen Sieg für Moskau. Dass sich die Machtverhältnisse schnell wieder ändern können, zeigte schon der erste Krieg zwischen 1994 und 1996. Auch damals wurde das von russischen Truppen besetzte Territorium einschließlich der Stadt Grosny von den Freischärlern wieder zurückerobert. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Wladimir Rubánow, äußert sich skeptisch zu den jüngsten russischen Erfolgsmeldungen:
O-Ton: "Es ist wahrscheinlich, dass Grosny in der nächsten Zeit von den föderalen Truppen erobert wird. Aber ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass man dann mit den Aufbauarbeiten beginnen kann, dass in Grosny ein normales Leben beginnt. Wahrscheinlich wird genau das Gegenteil der Fall sein. Ich glaube, Grosny wird einer der Schauplätze des Partisanenkampfes."
Je länger der Krieg dauert, desto lauter fordern russische Menschenrechtsorganisationen, wie die "Soldatenmütter", dass endlich eine Liste der gefallenen russischen Soldaten veröffentlicht wird. Doch daran haben die russischen Generäle offensichtlich kein Interesse. Die Mütterorganisation, die sich im letzten Tschetschenienkrieg um die vermissten und gefangengenommenen russischen Soldaten kümmerte, stützt sich bei ihren Angaben auf die Recherchen von 200 in ganz Russland arbeitenden Komitees. Die Verluste in diesem Tschetschenienkrieg sind sogar höher als im Krieg 1994/96. Während beim ersten Krieg im Monat durchschnittlich 188 Soldaten getötet wurden, verzeichnen die Gefallenenlisten derzeit 204 Soldaten pro Monat. Der neue Tschetschenienkrieg, mit dem sich die russischen Generäle auch für ihre 1996 erlittene Niederlage rehabilitieren wollen, hat alle Chancen wieder in einer Katastrophe zu enden. Bei einer abendlichen Talkshow vor kurzem im russischen Fernsehkanal NTW, meldeten sich Experten mit eindringlichen Warnungen zu Wort. Páwel Félgengauer, einer der führenden russischen Militärspezialisten - er arbeitete früher bei der prowestlichen Zeitung "Sewódnja" - erklärte, das anfängliche Ziel der Militärs, den Nordteil Tschetscheniens zu besetzen, sei noch realisierbar gewesen. Mit den gleichen Kräften dann aber auch noch die Stadt Grosny und die Berge erobern zu wollen, werde zwangsläufig in einer Katastrophe enden. Als Beispiel für die schlechte Kampfmoral vieler Soldaten nannte er den Fall des Generals Maloféjew, der vor gut zwei Wochen bei einem Nahkampf ums Leben kam. Für Félgengauer ist klar: Mit den Tschetschenen muss unverzüglich verhandelt werden:
O-Ton: "Sonst zerfällt die Armee vor unseren Augen. Was mit General Maloféjew passierte ist, war ein erstes Alarmsignal. Der General versuchte die Soldaten, die nicht angreifen wollten, in den Kampf zu führen. Sie sind ihm nicht gefolgt, sie haben ihn allein gelassen. So etwas gab es in der 1000jährigen Geschichte der russischen Armee und des russischen Staates nicht (...). Die Armee kann zerfallen. Das kann zu einer Katastrophe führen. Deshalb müssen die Truppen jetzt unverzüglich zurückgezogen werden."
In der selben Sendung trat auch einer der Leiter des russischen Informationszentrums zum Tschetschenienkrieg, General Alexánder Michajlow, auf. Dieser Nordkaukasusexperte, der in der Vergangenheit führende Posten im Geheimdienst und in der russischen Regierung innehatte, bezweifelt offen, dass es der russischen Führung gelingen werde, die Freischärler ausschließlich mit militärischem Mitteln zu besiegen:
O-Ton: "Ich kann bis heute nicht verstehen, worin die strategische Absicht besteht, Grósny zu erobern. (...) Wozu brauchen wir Grosny in dem Zustand, in dem sich die Stadt jetzt befindet? Niemand wird die Stadt wieder aufbauen. Offensichtlich geht es darum, die eigenen Kräfte zu zeigen und die Flagge zu hissen. (...) Die militärische Operation muss natürlich abgeschlossen werden. Wir müssen das erreichen, was wir erreichen können. (...) Aber mich beunruhigt Folgendes: Wenn unsere Truppen erstmal Tschetschenien angeblich 'kontrollieren' und dann abziehen, überlassen sie das Gebiet dem russischen Innenministerium. In dieser Situation wird es zur totalen Niederlage kommen, zur völligen Auflösung der Armee und der Truppen des Innenministeriums."
Die Soldatenmütter, die in den letzten Wochen wieder verstärkt von sich reden machen, spielten schon im letzten Tschetschenienkrieg eine wichtige Rolle. Sie fuhren auf eigene Faust und eigenes Risiko nach Tschetschenien, suchten nach ihren verschollenen Söhnen, verhandelten mit beiden Seiten, mit russischen Generälen und den Freischärlern. Sie organisierten die Freilassung von russischen Kriegsgefangenen. Im kleinen Büro der "Soldatenmütter" in der Moskauer Lútschnikow-Gasse drängen sich Ratsuchende. Auch Ljubów Stepánowa hofft hier auf Hilfe bei der Suche nach ihrem in Tschetschenien verschollenen, wehrpflichtigen Enkel Serjósha. Irgendwann, nach langem Warten, kann sie endlich an dem Arbeitstisch von Walentína Mélnikowa, der Komitee-Vorsitzenden Platz nehmen. Bábuschka Ljubów erzählt, das letzte Lebenszeichen von Sergej habe sie am 9. November erhalten. "Wie kann ich ihn finden?", fragt Ljubów Stepánowa und schaut die Vorsitzende der "Soldatenmütter" eindringlich, schon fast flehentlich an. Aber ein Mindestmaß an Formalitäten muss trotzdem sein. Walentina reicht Ljubow erst einmal ein Formblatt, in dem sie die persönlichen Daten des Vermissten eintragen soll. 2.500 solcher Formulare wurde im letzten Jahr allein in Moskau ausgefüllt. Also macht sich Babuschka Ljubow ans Schreiben. Seit Mai 1998 leistet der 20-jährige Sergéj Wiktorowitsch Grozunów, seinen Wehrdienst im südrussischen Nowotscherkássk. Die Patentante, die Sergéj besuchte, erzählte, er werde schlecht ernährt und trage seine Zivilkleidung. Bei der Armee herrsche offenbar nicht nur Mangel an Lebensmitteln sondern auch an Kleidung, ist sich Bábuschka Ljubów sicher. Nur durch Zufall erfuhr sie dann, das man Sergej im vergangenen Spätsommer nach Dagestan geschickt hatte. Dorthin waren Kämpfer aus Tschetschenien eingedrungen. Die russische Armee versuchte sie wieder zu vertreiben.
O-Ton: "Ich habe ihm 50 Rubel von meiner Rente in die Kaserne nach Nowotscherkássk geschickt, (...) damit er sich Zahnpasta und Zigaretten kaufen kann. Das Geld kam zurück. Als auch die nächsten 100 Rubel zurückkamen, forschten wir nach und bekamen heraus, dass er in Dagestan ist. (...) Im Oktober letzten Jahres kam er dann nach Tschetschenien. (...) Anfang November kam ein Brief. Sergej schreibt, seine Einheit sei auf einem Feld stationiert. Sie führen in den Ortschaften "Säuberungen" durch, essen Melonen, trinken Melonen und waschen sich mit Melonen. Wahrscheinlich haben sie kein Wasser. (...) Er schreibt, nachts sehe er die Raketen fliegen. Schön sehe das aus - und irgendwie schrecklich. Wenn sie in ein Dorf einrücken, bringen die tschetschenischen Frauen Weintrauben und Milch. Die Soldaten nehmen die Geschenke aber nicht an, aus Angst, das sie vergiftet sind. Er schreibt: Habt keine Angst um mich. Wahrscheinlich werde ich hier bis zum Ende meines Dienstzeit bleiben.."
Seit zwei Monaten hat Großmutter Ljubów nichts mehr von ihrem Enkel gehört. Briefe an ihn kommen zwar nicht zurück. Aber beruhigt ist sie deshalb keineswegs. Alle paar Tage ruft Ljubów Stepánowa beim sogenannten "Heißen Draht" des Innenministeriums an, einem Informationsdienst für Soldaten-Angehörige. Dort sagt man ihr immer wieder, Sergej stehe auf keiner der Listen, d.h., er sei weder tot, noch verletzt, noch vermisst. Valentina Melnikowa erinnert an die Anfänge des jüngsten Tschetschenienkrieges. Die Komitees, sagt sie, hätten schon im August ´99, als es in Dagestan wieder losging, gegen den Krieg opponiert. Die russischen Journalisten schweigen unsere Arbeit tot, beklagt sich Frau Mélnikowa. Erst als die Soldatenmütter vor kurzem die Zahl von 3.000 gefallenen russischen Soldaten veröffentlichten, kam ihre Organisation in die Schlagzeilen. Walentína Mélnikowa verweist auf die Zensur, unter der die russischen Medien heute stünden:
O-Ton: "Die Journalisten erwarten, dass die Leute gleich auf die Straße gehen und dort irgendetwas schwenken. In Russland führt das aber zu nichts. Das endete 1993 mit der Auflösung des Parlaments. (...) Es wurde klar, das man für alles mögliche auf die Straße gehen kann, dass das aber keine Wirkung hat. Man muss andere Methoden finden. Zum Beispiel auf die Eltern einwirken, die ihre Kinder zur Armee schicken und auf die Abgeordneten, die Gesetze machen."
Sprecher: Ständig klingelt in dem kleinen Büro das Telefon. Die Anrufer holen Rat ein oder fragen, ob es Neuigkeiten aus Grosny gibt. Einen Erfolg habe man schon erreicht, berichtet Walentina Melnikowa zufrieden. Mit Unterstützung der Duma-Fraktion "Frauen Russlands" habe man bewirkt, dass im Haushalt für das Jahr 2.000 wenigstens die Finanzierung der Forschungsstelle für Vermisste in Rostów am Don gesichert ist. In den Kühlwaggons dieses berühmt-berüchtigten, sogenannten "Laboratoriums" in Südrussland, liegen immer noch Hunderte von Soldatenleichen - aus dem ersten Tschetschenienkrieg. Bis heute hat man sie nicht identifiziert. Walentína Mélnikowa weiß aber auch, dass im Umgang mit der Macht ein Mindestmaß an Kompromissbereitschaft notwendig ist:
O-Ton: "Wir haben zu allen Sicherheitsstrukturen und zur Armee gute Beziehungen. Denn was wir fordern, müssten sie als verantwortliche Personen eigentlich ohnehin ausführen. Nur: Wenn sich eine Mutter alleine an die Militärs wendet, sagen die ihr sofort: 'Dein Sohn ist schlecht. Du bist auch schlecht und überhaupt: Bring ihn zurück in die Kaserne!' Wir treten als Vermittler auf. Auf der einen Seite dämpfen wir den Schmerz und die Entrüstung der Eltern. Auf der anderen Seite reduzieren wir die Geringschätzung und die Arroganz der Militärs."
Russische Eltern leben heute oft in einem Zwiespalt. Sie stehen zu ihrer russischen Armee, fürchten aber gleichzeitig, ihren Sohn dorthin zu geben, ihn dem oft mörderischen Strafsystem in den Kasernen und der Selbstherrlichkeit der Generäle auf den Schlachtfeldern zu überlassen. Eine grundlegende Militärreform hat es in Russland - trotz mehrfacher Ankündigung - bis heute nicht gegeben. In der Armee gelten immer noch die Prinzipien aus Sowjetzeiten. Gerade in Kriegszeiten wird deutlich, das junge Wehrpflichtige für die Führung nicht viel mehr als Kanonenfutter sind. Sie kosten fast nichts, über den "Verbrauch" legt ohnehin niemand Rechenschaft ab - so ihr zynisches Kalkül. Einzelne Vertreter der russischen Sicherheitsstrukturen unterstützen inzwischen aber immerhin die Forderung der "Soldatenmütter" nach einer umfassenden Militärreform sowie einer Berufsarmee. Arkádij Baskájew etwa, Kommandeur der Truppen des Innenministeriums im Moskauer Militärbezirk, aus dem 5.000 Mann nach Tschetschenien abkommandiert wurden, erklärte vor kurzem im Fernsehen:
O-Ton: "Es dürfen keine jungen Männer sterben. Ich bin auch ganz für den sofortigen Aufbau einer Berufsarmee. Die Vertreterin der Soldatenmütter hat völlig Recht. Solch eine Operation, wie sie jetzt in Tschetschenien läuft, darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen eine professionelle Armee."
Bis heute hat die russische Regierung kein offizielles Dokument vorgelegt, aus dem hervorgeht, auf welcher Basis und mit welchem Ziel dieser Krieg in Tschetschenien geführt wird. María Fedúlowa von den "Soldatenmüttern" will es aber gerade deshalb genau wissen:
O-Ton: "Was geht im Kaukasus zur Zeit überhaupt vor? Niemand weiß das. Unsere Journalisten sagen, es sei ein Krieg gegen Terroristen. Gut, aber wo sind die Dokumente, die das bestimmen? (...) Wir haben schon zu Anfang des Krieges vom Staat gefordert, dass er erklärt, was im Kaukasus vor sich geht. Ist es ein Krieg gegen Terroristen? Gegen Banditen? Warum sterben bei uns die jungen Soldaten? Was haben sie für einen Status? Unsere Regierung schweigt, insbesondere auch der geschäftsführende Präsident, Herr Putin. Wenn es ein Krieg gegen den Terrorismus ist, wie sie sagen, dann muss es für die Soldaten und ihre Familien aber auch die entsprechenden Zahlungen geben."
Wenn ein Wehrpflichtiger im Kampf gegen den Terrorismus fällt, bekommt jedes Mitglied seiner Familie als Entschädigung 500 mal den Monatssold von 800 Rubel, macht pro Person umgerechnet 28.000 Mark. Doch es fehlen die Regierungserlasse, die bestimmen, um welche Art Krieg es sich dort in Tschetschenien eigentlich handelt. Im Nordkaukasus führt der Kreml faktisch einen unerklärten Krieg mit schweren Waffen. Regierung und Verteidigungsministerium beeilen sich aber keineswegs, einen offiziellen Erlas zu veröffentlichen, der die Kriegsart und die Kriegsziele definiert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Woher soll das Geld für Entschädigungszahlungen kommen? Die Kassen sind leer. Wenn es keine staatsoffizielle Grundlage für diesen Krieg gibt, dann braucht die Regierung auch keine Entschädigungen für gefallene und verwundete Soldaten zu zahlen: Eine makabre aber nachvollziehbare Logik. Doch nicht nur Entschädigungen und Rentenzahlungen bleiben aus. Komiteevorsitzende Walentína Mélnikowa berichtet, dass die Soldaten in Tschetschenien heute praktisch auch keinerlei Sold bekommen. Man verspricht den Wehrpflichtigen zwar 800 Rubel im Monat, das sind umgerechnet 60 Mark. Aber ausgezahlt wird nichts. Meist heißt es nur lapidar: Eröffnen Sie doch erstmal ein Konto bei der Sparkasse:
O-Ton: "Unser strategisches Ziel ist eine Militärreform. Zunächst soll die Einberufung abgeschafft werden. Unsere zehnjährige Erfahrung zeigt, dass es keinen anderen Weg gibt. Die Brutalität, der Hunger und das Strafsystem für die Soldaten lassen sich nicht anders abschaffen. (...) Der Wehrpflichtige ist zwar noch Bürger Russlands, aber praktisch verliert er alle seine Rechte. (...) Wenn er geschlagen wird, kann er sich nur an seinen Kommandeur wenden, der die Prügel deckt und provoziert. (...) Wie kann ein Soldat einen Militärstaatsanwalt aufsuchen, wenn dessen Dienststelle in einer anderen Stadt ist und der Wehrpflichtige in der Kaserne von der Außenwelt praktisch völlig abgeschottet ist? (...) Handys, wie so viele Bundeswehrsoldaten, die haben unsere Soldaten nicht."
Walentina Melnikowa erinnert sich bei diesen Worten an einen Besuch in einem Münchner Fernsehstudio, wo sie erstaunt mitbekam, wie eine Mutter von ihrem wehrpflichtigen Sohn aus einer Bundeswehr-Kaserne per Handy angerufen wurde. Eine zweite wichtige Forderung der Soldatenmütter ist der Erlass eines Zivildienstgesetzes in Rußland. Diese Alternative zum Militärdienst ist zwar in der russischen Verfassung schon festgeschrieben, aber es gibt immer noch kein Gesetz, das Ausführung und Einzelheiten regelt. "Der neue Krieg hat das Zivildienstgesetz erst einmal wieder begraben", meint die Vorsitzende frustriert - aber voller Einsicht in die Realität. Jeden Montagabend fährt Walentína Melnikowa nach ihrem Bürodienst in den Süden Moskaus. Dort, im "Haus der Veteranen" hält sie eine öffentliche Sprechstunde für einen größeren Kreis von Ratsuchenden ab. Vor allem wenn im Frühjahr und Herbst die Einberufungen laufen, kommen manchmal bis zu 500 Menschen. An diesem Abend sind es rund einhundert Besucher: Eltern von Wehrpflichtigen und junge Männer, die keinen Wehrdienst leisten wollen. Walentína Mélnikowa spricht laut und eindringlich. Die Anwesenden sollen sich keine Illusionen machen. Denn wer sich mit dem Verteidigungsministerium anlegt - das macht Melnikowa deutlich - braucht eine Menge Dokumente, Selbstdisziplin u n d eine gesunde Portion Misstrauen:
O-Ton: "Noch einmal: Machen Sie sich klar - im Land herrscht Krieg! (...) Wie viele junge Soldaten sind schon umgekommen, obwohl Mitarbeiter der Einberufungsbehörden vielen Müttern gegen Schmier-Geld versprochen haben, dass der Sohn seinen Wehrdienst in der Nähe des Elternhauses wird ableisten können. (...) Also: Verlassen sie sich auf nichts in unserem Land, rechnen sie mit keinerlei Mitgefühl!"
Alle jungen Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren fallen in Russland unter die Wehrpflicht. Einen Aufschub bekommt nur, wer studiert, Familienangehörige versorgen muss oder gesundheitlich angeschlagen ist. Aber: Selbst nach Berechnungen des russischen Gesundheitsministeriums sind augenblicklich nur zwei Prozent der Wehrpflichtigen als "völlig gesund" einzustufen. Mit eindringlicher, fast schon beschwörender Stimme versucht Walentína Mélnikowa die Eltern und die jungen Männer davon zu überzeugen, dass der Weg zu einem Dienstpflicht-Aufschub oder gar zur Freistellung vom Wehrdienst dornig ist, dass man Disziplin und einen kühlen Kopf braucht, dass man sich um die nötigen Dokumente kümmern muss. Sich als Wehrpflichtiger zum Beispiel einfach irgendwo im fernen Sibirien zu verstecken, biete nicht automatisch Schutz. Denn auch dort gebe es Miliz und Militärpolizei. Deshalb rät sie, durchaus aufmunternd: Wenn man alles offiziell machen kann, um so besser...
Es ist spät geworden an diesem Abend. Allmählich wird es im Saal unruhig. Die Menschen stecken ihre Aufzeichnungen ein. Aber für Walentina Melnikowa ist der Arbeitstag noch nicht zuende. Sie wird noch in einem Moskauer Rundfunkstudio erwartet. Immerhin - trotz indirekter Zensur und manch vorauseilender Selbstzensur ist bei einigen Moskauer Sendern ihre Stimme inzwischen hin und wieder zu hören. Noch aber überwiegen im Chor der elektronischen Medien Russlands die staatstragenden, patriotisch-autoritären Töne.
veröffentlicht in: Deutschlandfunk