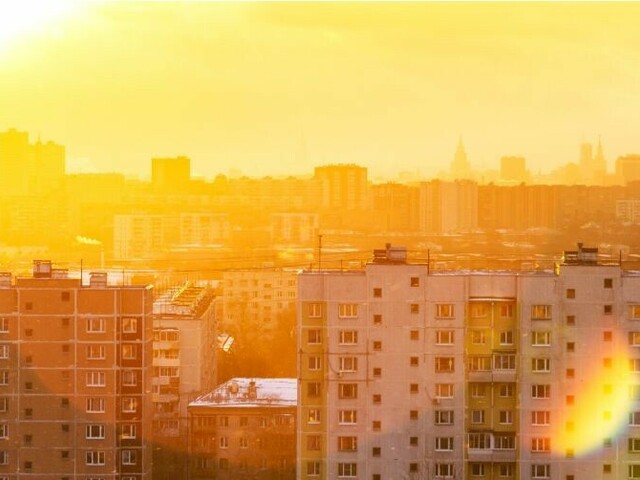Klemmendes Fenster
Um unabhängiger von den Balten zu werden, baut Russland seine Ostseehäfen aus.
Vom Finnischen Meerbusen weht eine frische Brise. Alexander Michailow stapft durch den frisch aufgeschütteten Sand und zeigt auf die vier großen Dieseltanks.
"40 Millionen Dollar haben wir in den letzten vier Jahren hier investiert". Der stellvertretende Direktor des Petersburger Ölterminals (PNT) ist stolz auf das bisher Geleistete. Wo jetzt die im Sonnenlicht funkelnden Edelstahltanks stehen, peitschten früher die Ostseewellen. Hoch oben, zwischen den neuen Verstrebungen und Leitungen wird geschweißt und gehämmert. "Rund um die Uhr", meint Michailow.
Die Russen haben es eilig. Schnellstmöglich wollen sie ihre Abhängigkeit von den baltischen Häfen reduzieren, über die derzeit noch ihr Erdöl nach Europa verschifft wird. Im lettischen Ventspils, dem ehemaligen Windau, werden jährlich 30 Millionen Tonnen, in Estland zehn Millionen Tonnen und im litauischen Klaipeda (Memel) jährlich vier Millionen Öl- und Ölprodukte umgeschlagen - insgesamt ein Viertel des russischen Ölexports. Und die dortigen Hafenbetreiber bitten ihre russischen Nachbarn für die Dienstleistung kräftig zur Kasse: 15 Prozent der gesamten Exportkosten entfielen auf Transitgebühren an Nachbarstaaten, rechnet Dmitri Saweljew vor, ehemaliger Präsident des staatlichen russischen Pipelinemonopolisten Transneft. Das summiere sich im Jahr zu Beträgen von mehreren Hundert Millionen Dollar im Jahr.
Das Geld würden sich die russischen Ölbarone und Pipelinebetreiber lieber in die eigene Tasche stecken. Die Transneft hat sich deshalb entschlossen, an der Nordküste des Finnischen Meerbusens, bei der Stadt Primorsk, einen neuen Ölterminal zu bauen. Ende März wurde der Grundstein dazu gelegt. Gleichzeitig begannen die Arbeiten an einer 460 Kilometer langen Pipeline, die Primorsk mit dem Fördergebiet Tymano-Petschorsk in der nordrussischen Republik Komi verbindet.
Von den veranschlagten Gesamtkosten von rund 500 Millionen Euro ist derzeit allerdings nur ein kleiner Teil gesichert. Alle russischen Pipelinebesitzer zusammen haben eine Investitionsabgabe von rund 110 Millionen Euro aufgebracht. Einen erhofften Kredit der Europäischen Bank für Wiederaufbau hat man nicht bekommen. "Wir konnten die Bedingungen nicht akzeptieren", sagt Transneft-Vize Sergej Gregorjew. Angeblich forderte die Europäische Bank eine Fortführung der Pipeline bis nach Finnland. Außerdem wollte die Bank nicht akzeptieren, dass der russische Staat sich nur zu 30 Prozent an dem Projekt beteiligt.
Nach Abschluss der ersten Bauetappe, Ende 2001, sollen von dem neuen Terminal Primorsk aus jährlich zwölf Millionen Tonnen Öl, später 35 Millionen Tonnen auf den Weltmarkt exportiert werden. Das wäre ein Drittel der russischen Ölexporte, die sich im vergangenen Jahr auf rund 100 Millionen Tonnen beliefen. Die Häfen in den baltischen Staaten gingen dann fast leer aus. Lettland verlöre dadurch eine seiner Haupteinnahmequellen.
Für Russlands neuen Premier Michail Kasjanow haben die eigenen Ölterminals an der Ostsee geopolitische Bedeutung - in seiner Antrittsrede vor der Duma in der vergangenen Woche wurde das Projekt Primorsk ausdrücklich erwähnt. Der Transit eines Großteils des russische Ölexports über klar westlich orientierte Länder sei nicht unproblematisch, betont auch Transneft-Chef Saweljew. Zumal das Verhältnis zu den baltischen Staaten alles andere als entspannt ist. Erst kürzlich warf Lettlands Präsidentin Vaira Vike-Freiberg Russland vor, die baltischen Republiken gegeneinander auszuspielen und den politischen Einfluss in Lettland ausweiten zu wollen. Die regierungsfreundliche Moskauer "Rossiskaja Gaseta" sprach von Hirngespinsten: Die Präsidentin Lettlands ärgere sich lediglich darüber, dass Russlands nun einen eigenen Ölterminal an der Ostsee baue und den baltischen Häfen das Geschäft verderbe.
Neben Primorsk ruht die Hoffnung der Russen vor allem auf dem Hafen ihrer einstigen Hauptstadt St. Petersburg. Die Stadt an der Newa verfügt heute über den einzigen russischen Ölterminal an der Ostsee. Bei der Übernahme des Terminal 1996 durch die Gesellschaft Petersburger Ölterminal wurden hier eine Million Tonnen Ölprodukte (transhipment) umgeschlagen. Im Jahre 1999 waren es bereits 3,5 Millionen Tonnen. Auch seine Lagerkapazitäten hat der Terminalbetreiber Schritt für Schritt ausgebaut - zurzeit können hier 114 000 Kubikmeter gebunkert werden. Im Vergleich mit den Ölterminals im Baltikum ist der Petersburger Hafen jedoch immer noch ein kleiner Fisch. Der lettische Ölterminal in Ventspils hat eine Lagerkapazität von einer Million Kubikmeter.
St. Petersburg hat noch mit weiteren Handikaps zu kämpfen. Im Winter friert der Hafen regelmäßig zu. Auch sommers kann er von größeren Tankern nicht angefahren werden: Die 1885 geschaffene Fahrrinne im Finnischen Meerbusen hat lediglich eine Tief von elf Metern. Erst in den nächsten zwei Jahren soll die Fahrrinne auf 13 Meter vertieft werden. Das Öl, das mit Flussdampfern von Raffinerien an der Wolga, aus Baschkortostan, Tatarstan und Samara nach St. Petersburg gebracht wird, muss deshalb zunächst an mobilen Stationen in der Bucht auf 35 000-Tonnen-Tanker umgeladen werden. Da diese Methode teuer und auch ökologisch nicht ganz unbedenklich ist, baut die Betreibergesellschaft ihre Lagerkapazitäten an Land weiter aus. Bereits jetzt können zwei 35 000-Tonnen-Tanker am Kai abgefertigt werden. Die Tanker laufen europäische Häfen an, vor allem in Skandinavien und Großbritannien. Deutsche Banken und Unternehmen haben an dem Ausbau des St. Petersburger Hafens großen Anteil. "Für fünf Millionen Dollar haben wir Ausrüstung in Deutschland gekauft", berichtet Alexander Michailow, der stellvertretende Direktor des Petersburger Ölterminals. Absauganlagen, Filter und Pumpen - bei solch wichtigen Techniken vertraue man deutschen Unternehmen mehr als russischen , meint Michailow. Bei den Verhandlungen mit den deutschen Firmen kommen dem gelernten Chemiker Erfahrungen zugute, die er Ende der Achtzigerjahre bei einer Fortbildung an der Hamburger Universität machte. Heute kauft Michailow die Ausrüstung für seinen Terminal selbst in Deutschland ein. "Unsere Konten führen wir bei der Filiale der Dresdner Bank in St. Petersburg."
Das deutsche Geldinstitut hatte der heutige Staatspräsident Wladimir Putin nach St. Petersburg geholt - Anfang der Neunzigerjahre war Putin als Referent des damaligen Petersburger Bürgermeisters Anatoli Sobtschak Leiter des Komitees für Außenbeziehungen und auch für die Wirtschaftsförderung in der Region zuständig. Die Privatisierung des Petersburger Hafens gilt als sein Werk.
Auf dem Hafengelände wirtschaften heute 21 private Speditionen und Terminals. Größter Anteilseigner der Hafengesellschaft ist Nasdor Incorporated, eine Gesellschaft mit Sitz in Liechtenstein. Ihr Aktienpaket vergrößerte die Gesellschaft kürzlich von 29 auf 49 Prozent. Im Direktorenrat, in dem auch der russische Staat und die Stadt Petersburg vertreten sind, hat die Nasdor 69 Prozent der Stimmen.
Hinter der Offshore-Gesellschaft aus Lichtenstein steht angeblich ein Petersburger Bankenkonsortium. Mit der Gründung der Offshore-Firma wollten die Petersburger Finanziers nicht nur Steuern sparen, sondern offensichtlich auch eine lästige Bestimmung des russischen Gesetzes umgehen, nach der eine einzelne Bank nur bis zu zehn Prozent der Aktien eines Unternehmens halten darf.
Für ausländische Investoren wirken die undurchsichtigen Offshore-Firmen sowie die zunehmende Zahl von Auftragsmorden in St. Petersburg - seit Jahresbeginn wurden 17 russische, in der Energiebranche tätige Geschäftsleute ermordet - aber nicht besonders einladend: Ein von der Weltbank vor zwei Jahren geplanter 170-Millionen-Dollar-Kredit für die Häfen Noworosisk und St. Petersburg kam bislang nicht zu Stande. Hafendirektor Igor Rusu reagiert trotzig: "Wir konzentrieren uns nun auf die Gewinnung russischer Finanzressourcen."
Als Peter der Große im Jahre 1703 die ersten Gebäude am Ufer der Neva errichten ließ, hatte er Großes vor: St. Petersburg sollte sein Tor zur Welt werden. Peter der Große ist lange tot, die Sowjetunion bald 10 Jahre zerfallen. Das Fenster zur Welt klemmt aber immer noch.
"Wirtschaftswoche"